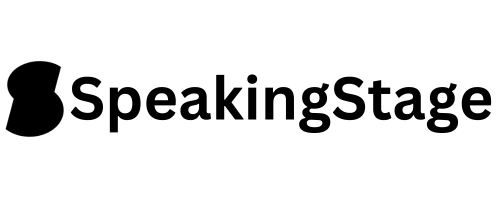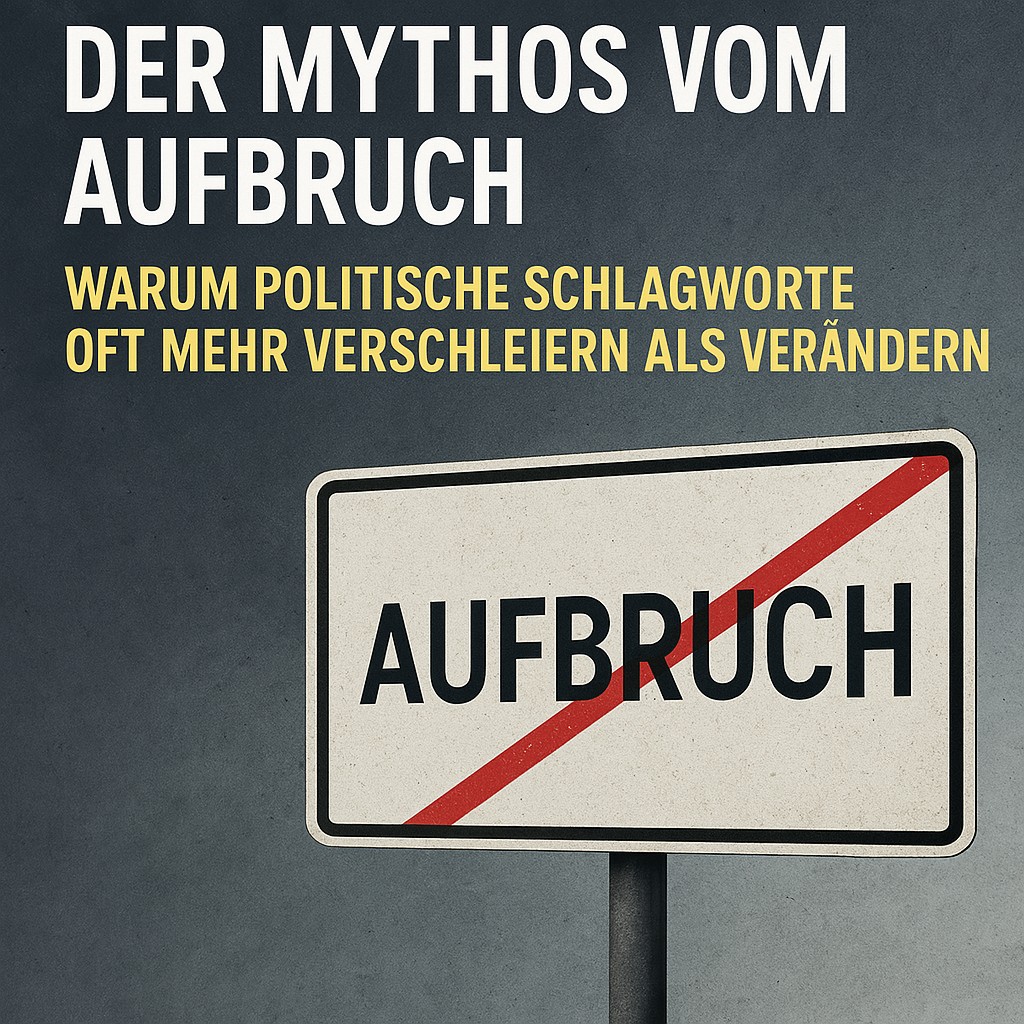
Der Mythos vom Aufbruch – Warum politische Schlagworte oft mehr verschleiern als verändern
Einleitung:
„Aufbruch für Deutschland“ – mit diesem verheißungsvollen Slogan tritt Friedrich Merz und die neue Koalition an. Doch was zunächst nach frischem Wind klingt, entpuppt sich bei näherer Betrachtung als altbekanntes Muster: große Worte, wenig Wandel. Der Begriff „Aufbruch“ wirkt wie ein politisches Allheilmittel, doch gerade in seiner inflationären Nutzung liegt die eigentliche Gefahr.
Der Begriff „Aufbruch“ – Zwischen Hoffnung und Stillstand
Der Begriff „Aufbruch“ oder „Umbruch“ wird in der politischen Rhetorik gerne genutzt, um Tatkraft zu signalisieren. Doch oft steht er für das Gegenteil. Denn in Wahrheit sind es meist die besonders trägen und wenig innovativen Institutionen, die sich selbst im Umbruch sehen: Langsame Hochschulen, langweilige Kleinstädte oder die evangelische Kirche, sind Orte, die eigentlich ständig im Umbruch sind, und deswegen umso unattraktiver wirken.
Diese Art der Selbstbeschreibung sollte aus ökonomischer Sicht hellhörig machen. Würden Hedgefondsmanager ausschließlich auf Unternehmen setzen, die sich im „Umbruch“ wähnen, könnten sie möglicherweise Gewinne durch fallende Kurse erzielen. Denn je häufiger Umbruch verkündet wird, desto weniger passiert tatsächlich. Der Begriff ist ein Warnsignal, kein Fortschrittsbeweis.
Wer ist eigentlich schuld? Die falsche Adressierung
Ein weiteres Problem liegt in der unterschwelligen Unterstellung, die mit dem Aufbruchsgerede einhergeht: Es wird suggeriert, dass bisher niemand wirklich etwas getan hätte. Dabei hat ein großer Teil der Bevölkerung, vor allem arbeitende Menschen, viel geleistet und durchgehalten. Die echten Versäumnisse liegen nicht in der Gesellschaft, sondern bei der Politik – die sich, so der Eindruck, noch immer im Dornröschenschlaf der Merkel-Ära befindet.
Gerade diese Diskrepanz zwischen realem Engagement der Bürger und politischem Stillstand sorgt für Frust. Während die Wählerinnen und Wähler längst verstanden haben, wie tiefgreifend die aktuellen Herausforderungen sind, folgt die Politik immer noch alten Mustern und liefert keine echten Lösungen.
Fehler in der politischen Strategie: Die CDU und die Fixierung auf die SPD
Friedrich Merz hat sich in seiner Koalitionsstrategie auf einen einzigen Partner fixiert: die SPD. Das mag aus machtpolitischer Sicht kurzfristig logisch erscheinen, erweist sich langfristig jedoch als strategischer Fehler. Denn eine Partei, die keine Alternativen zulässt, schwächt ihre eigene Verhandlungsposition massiv. Das ist so, als ob ein Baufinanzierungsvermittlers sich von vornherein zum Beispiel auf die Deutsche Bank festlegt. Auch den würden seine Kunden fragen, warum er seinen Handlungsspielraum freiwillig so schnell aufgibt.
Die SPD wiederum nutzt diese Situation geschickt aus. Obwohl sie die Wahl verloren hat, agiert sie, als hätte sie gewonnen. Ihr ist bewusst: Solange Merz an der Koalition festhält, kann sie trotz schlechter Umfragewerte weiterregieren – notfalls auch mit nur noch 16 Prozent Zustimmung. Für echte Reformen ist das ein fatales Signal. Dafür gibt es Füllwörter wie „Aufbruch“.
Das Wort „Aufbruch“ bewirkt das Gegenteil
Der inflationäre Gebrauch von Begriffen wie „Aufbruch“ oder „Umbruch“ ist mehr als nur rhetorische Spielerei. Er ist ein Spiegelbild politischer Hilflosigkeit und eine Gefahr für Vertrauen und Zuversicht. Unternehmen, die auf Stabilität und Verlässlichkeit angewiesen sind, sehen sich einem politischen Klima gegenüber, das große Versprechungen macht, aber wenig Substanz liefert. Bürger wiederum fühlen sich durch leere Phrasen getäuscht – was langfristig zu Politikverdrossenheit führen kann. Denn jeder weiß: Je mehr irgendwo „Aufbruch“ draufsteht, desto weniger passiert hinterher. Das Wort „Aufbruch“ trägt das Scheitern dieses Aufbruchs bereits in sich.
Der Begriff „Aufbruch“ – Zwischen Hoffnung und Stillstand
Der Begriff „Aufbruch“ oder „Umbruch“ wird in der politischen Rhetorik aber auch bei Unternehmenstransformnationen gerne genutzt, um Tatkraft zu signalisieren. Doch oft steht er für das Gegenteil. Denn in Wahrheit sind es meist die besonders trägen und wenig innovativen Institutionen, die sich selbst im „Aufbruch“ oder auch „Umbruch“ sehen: Langsame Hochschulen, langweilige Kleinstädte oder die evangelische Kirche sind Orte, die eigentlich ständig im Umbruch sind, und deswegen umso unattraktiver wirken.
Diese Art der Selbstbeschreibung sollte aus ökonomischer Sicht hellhörig machen. Würden Hedgefondsmanager ausschließlich auf Unternehmen setzen, die sich im „Umbruch“ wähnen, könnten sie möglicherweise Gewinne durch fallende Kurse erzielen. Denn je häufiger Umbruch verkündet wird, desto weniger passiert tatsächlich. Der Begriff ist ein Warnsignal, kein Fortschrittsbeweis.
Wer ist eigentlich schuld? Die falsche Adressierung
Ein weiteres Problem liegt in der unterschwelligen Unterstellung, die mit dem Aufbruchsgerede einhergeht: Es wird suggeriert, dass bisher niemand wirklich etwas getan hätte. Dabei hat ein großer Teil der Bevölkerung, vor allem arbeitende Menschen, viel geleistet und durchgehalten. Die echten Versäumnisse liegen nicht in der Gesellschaft, sondern bei der Politik – die sich, so der Eindruck, noch immer im Dornröschenschlaf der Merkel-Ära befindet. Die Politik muss aufwachen. Dafür brauchen die Bürger aber keine Aufforderung zum „Aufbruch“ (wohin eigentlich?)
Fehler in der politischen Strategie: Die CDU und die Fixierung auf die SPD
Friedrich Merz hat sich in seiner Koalitionsstrategie auf einen einzigen Partner fixiert: die SPD. Das mag aus machtpolitischer Sicht kurzfristig logisch erscheinen, erweist sich langfristig jedoch als strategischer Fehler. Denn eine Partei, die keine Alternativen zulässt, schwächt ihre eigene Verhandlungsposition massiv. Das ist so, als ob ein Baufinanzierungsvermittler sich von vornherein zum Beispiel auf eine einzige Bank festlegt. Auch den würden seine Kunden fragen, warum er seinen Handlungsspielraum freiwillig so schnell aufgibt.
Die SPD wiederum nutzt diese Situation geschickt aus. Obwohl sie die Wahl verloren hat, agiert sie, als hätte sie gewonnen. Ihr ist bewusst: Solange Merz an der Koalition festhält, kann sie trotz schlechter Umfragewerte weiterregieren – notfalls auch mit nur noch 16 Prozent Zustimmung. Für echte Reformen ist das ein fatales Signal. Dafür gibt es Füllwörter wie „Aufbruch“.
Das Wort „Aufbruch“ bewirkt das Gegenteil
Der inflationäre Gebrauch von Begriffen wie „Aufbruch“ oder „Umbruch“ ist mehr als nur rhetorische Spielerei. Er ist ein Spiegelbild politischer Hilflosigkeit und eine Gefahr für Vertrauen und Zuversicht. Unternehmen, die auf Stabilität und Verlässlichkeit angewiesen sind, sehen sich einem politischen Klima gegenüber, das große Versprechungen macht, aber wenig Substanz liefert. Bürger wiederum fühlen sich durch leere Phrasen getäuscht – was langfristig zu Politikverdrossenheit führen kann. Denn jeder weiß: Je mehr irgendwo „Aufbruch“ draufsteht, desto weniger passiert hinterher. Das Wort „Aufbruch“ trägt das Scheitern dieses Aufbruchs bereits in sich.