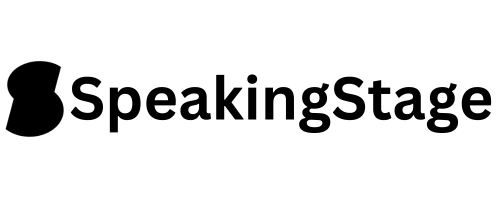Schwarz Rot droht, die CDU mit in den Abgrund zu reißen. Wie Merz den Trend stoppen kann
„Die Samurai sagen: Eine Kampf gewinnt nur der, der bereit ist zu sterben.“ Dieses Zitat steht nicht für Todessehnsucht, sondern für kompromisslose Entschlossenheit. Wer führen will – in der Politik wie in der Wirtschaft – muss bereit sein, Risiken einzugehen. Das ist genau das, was Friedrich Merz jetzt tun muss.
Unfallchirurgie oder gleich Leichenhalle?
Die SPD ist bereits auf dem Weg von der Intensivstation in die Leichenhalle. Diese einst traditionelle und ehrwürdige Partei zeigt seit Jahren, was passiert, wenn eine Partei lieber den langsamen Abstieg wählt, statt echte Veränderung zu wagen. Sie macht immer weiter wie bisher: mehr Sozialausgaben, mehr Staatsinterventionen, weniger Vertrauen in die Selbstregulierungskraft von Wirtschaft und Gesellschaft. Die Realität draußen – steigende Kriminalität, ungelöste Migrationsprobleme, wachsender Kontrollverlust und gleichzeitig eine vom Amtsschimmel drangsalierte Wirtschaft – wird mit immer neuen Symbolmaßnahmen beantwortet – im Zweifelsfall durch Erhöhung der Sozialausgaben. Doch das Vertrauen schwindet weiter. Die Quittung: historische Tiefstwerte in den Umfragen, aktuell bei 13 Prozent. Und trotzdem wird nicht grundlegend hinterfragt, sondern lediglich weiter verwaltet. Sie wirkt wie eine Partei, die sich mit dem eigenen Untergang abgefunden hat. Oder die den eigenen Untergang gar nicht fürchten muss. Denn wenn man einen Koalitionspartner wie die CDU ergattert, der auf Biegen und Brechen mit der SPD koalisieren will und muss, kann man sich auch als gerade noch zweitstellige Partei so benehmen, als hätte man die Wahl gewonnen.
Damit sind wir bei der Partei, die zwar noch nicht auf der Intensivstation, aber mit einigen Blessuren in der Unfallchirurgie sitzt: Denn auch auf Seiten der Union ist kein klarer Kurs zu erkennen. Friedrich Merz gelingt es zwar, Deutschland außenpolitisch wieder sichtbarer und kantiger zu positionieren. Sein Besuch bei Trump war exzellent geplant und durchchoreographiert und auch sonst ist Merz außenpolitischer Fußabdruck, nicht nur was sein Englisch angeht, eine Erleichterung nach Olaf Scholz, bei dem man nie wusste, ob er von der Außenwelt überhaupt irgendetwas mitbekommt.
Glamour versus Innenpolitik
Doch das allein reicht nicht. Außenpolitik bringt Glamour und Beliebtheit, aber gewählt und gewonnen wird an der „Heimatfront“. Und dort dominiert der Eindruck: Die CDU lässt sich treiben – und mit ihr der Vorsitzende. Die Versprechen sind ambitioniert: Entlastung für die Wirtschaft, Begrenzung unregulierter Migration, Aufrüstung der Bundeswehr. Aber in der Umsetzung ist davon kaum etwas zu spüren. Stattdessen hat man der SPD – einem deutlich kleineren Koalitionspartner – Schlüsselministerien überlassen: Finanzen und Arbeit. Ausgerechnet dort, wo in wirtschaftlich schwierigen Zeiten Steuerung notwendig wäre – denn genau in diesen beiden Ministerien wird das Geld verwaltet und auch das meiste Geld ausgegeben.
Es entsteht der Eindruck, als wolle die CDU diese Koalition um jeden Preis erhalten – aber nicht führen. Und das ist genau das Problem. Denn jede gute politische Strategie – wie auch jede gute Unternehmensstrategie – lebt vom klaren Narrativ, einer Story oder Geschichte. Und in jeder starken Geschichte gibt es zwei Schurken. Der erste Schurke ist das Risiko, wenn man handelt: Konflikte, Unsicherheit, möglicher Machtverlust. Der zweite Schurke ist oft größer und symbolisiert das, was passiert, wenn man nicht handelt: Stagnation, Bedeutungsverlust, strategischer Totalschaden.
Der zentrale Konflikt dieser politischen Geschichte ist längst da. Und die Entscheidung, welchem Schurken sich gestellt wird, steht aus. Friedrich Merz müsste bereit sein, diese Koalition notfalls aufzukündigen. Nicht, weil es populär ist. Sondern weil es notwendig wäre, um wieder handlungsfähig zu werden. Vorbilder gibt es genug. Auch Gerhard Schröder, den sich mancher, wie auch dieser Autor, zurücksehnt, war sich bei allem ihm unterstellten Willen zu Macht nicht zu schade, mit Rücktritt zu drohen, um damals seinen grünen Koalitionspartner in die Spur zu bekomme. 1998 hatte Schröder für die SPD 1998 übrigens über 40 Prozent geholt. Eine Zahl, von der auch die CDU träumen kann.
Koalitionsbruch oder Zwangsehe?
Das ist aber nicht das einzige Problem der Union: Denn eine Koalition, in der die entscheidenden Hebel bei einem Partner liegen, der kaum noch Rückhalt in der Bevölkerung hat, ist keine Koalition auf Augenhöhe – sondern eine politische Zwangsehe. Wer das durchhält, um des Machterhalts willen, opfert mittelfristig seine eigene Glaubwürdigkeit. Und öffnet der AfD Tür und Tor.
Es geht dabei nicht darum, Konfrontation zu suchen, sondern darum, im entscheidenden Moment bereit zu sein, den Preis für Führung zu zahlen. Wer bereit ist, die „kleine Katastrophe“ (Koalitionsbruch) in Kauf zu nehmen, verhindert vielleicht das große Desaster: Die Gefahr, dass die CDU mit der SPD in den Abgrund gerissen wird und das Ende der politischen Mitte in Deutschland.
Diese Logik ist nicht nur politisch relevant. Auch Unternehmen stehen ständig vor der Wahl zwischen Sicherheit und Aufbruch, zwischen kurzfristiger Stabilität und langfristiger Relevanz. In einer Zeit, in der Veränderung zur Konstante geworden ist, braucht es Führungspersönlichkeiten, die nicht nur Entscheidungen verwalten, sondern Entscheidungen treffen – auch unter Unsicherheit und auch dann, wenn die Konsequenzen für die eigene Karriere nicht immer erfreulich sein können.
Könnten Neuwahlen nach einem Koalitionsbruch Merz die Kanzlerschaft kosten? Klares Ja. Genau das kann aber auch passieren, wenn die CDU zwei Jahre Juniorpartner der SPD spielt und es dann, wie bei der Ampel, am Ende unkontrolliert knallt. Die SPD wäre dann einstellig und die CDU dort, wo jetzt die SPD ist. Lachender Dritter wäre die AfD.
Es gewinnt am Ende der den Kampf, der bereit ist zu sterben. Oder ins Risiko zu gehen. Denn entweder Merz vernichtet, wenn es sein muss, die Koalition. Oder die Koalition vernichtet die CDU.
Heute auch erschienen in Focus Online: https://s.focus.de/c6af25abcd